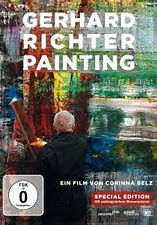Im Film „Werk ohne Autor“ tauchen im letzten Drittel vier Künstler auf, die sich in den 60-er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf begegneten.
In jenen Jahren besuchte ich in der Galerie Defet mit meinem Freund Ede Wolf das erste Mal Kunstaustellungen, machte einen Kunstkurs im Jugendzentrum bei Bodo Boden mit, verdiente mir bei der Nürnberger Biennale 69 Geld als Aufsicht und hatte Anfang der 70er Kontakt zu den damaligen Kunsterziehern Michael Popp und Wolfgang Zacharias (beide schon verstorben). Von Beuys und Ücker hatte ich Ahnung - von Richter und Polke wusste ich nichts.
Der Film zeigt recht gut, wie damals der Kunstbetrieb im Umbruch war. Malerei, Zeichnung und Druck waren in der Moderne aus. Aktion, Happening, Objektkunst waren in. Im Film erscheint als Randfigur in der Akademie HA Schult, der damals z.B. mit einer Ente ein paar Mal zwischen München und Hamburg hin und herfuhr. Die Windschutzscheiben mit den toten Insekten drauf wurden dann als Kunstobjekt verkauft ...
Beuys war damals bekannt als Margarine und Filzkünstler. Mit Hut und Anglerweste gerierte er sich oft als Kunstschamane und orientierte sich an der Anthroposophie Steiners. Fälschlicherweise oft Joseph Beuys zugeschrieben wird die deutsche Übersetzung eines Gedichts mit dem Titel „Jeder Mensch ist ein Künstler“ (Alternativtitel auch „Anleitung zum guten Leben“, „Lebe!“ oder benannt nach der ersten Zeile „Lass dich fallen“), das seit Jahren im Internet kursiert. Das englischsprachige Original („How to be an artist“) ist von der amerikanischen Künstlerin Sark.
Im Film wird in einer eindrucksvollen Szene seine Geschichte von der wundersamen Rettung nach einem Flugzeugabsturz im Krieg wiedergegeben. Der Absturz mit seiner Nachgeschichte diente Beuys als Stoff einer Legende, der zufolge nomadisierende Krimtataren ihn „acht Tage lang aufopfernd mit ihren Hausmitteln“ (Salbung der Wunden mit tierischem Fett und Warmhalten in Filz) gepflegt hätten. Diese Legende, die Beuys’ Vorliebe für die Materialien Fett und Filz erklären sollte und die Beuys in einem BBC-Interview ebenso beschrieb, hat auch sein Biograph Heiner Stachelhaus bis zuletzt vertreten. Einer Recherche des Künstlers Jörg Herold zufolge wurde Beuys schon bald nach dem Absturz von einem Suchkommando gefunden, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Herolds Spurensuche auf der Krim in einem Bericht vom 7. August 2000 meldete. Der acht- bis zwölftägige Aufenthalt bei den Tataren, wie ihn Stachelhaus und andere überliefern, wurde schon 1996 von Beuys’ eigener Ehefrau Eva in Zweifel gezogen. Die Witwe stufte die von ihrem Ehemann immer wieder erzählte Geschichte als „Fieberträume in langer Bewußtlosigkeit“ ein.
Seine Eskapaden als Rektor der Akademie sollten politisch sein, hatten aber kaum Auswirkungen auf den späteren Lehrbetrieb.
Ücker war damals schon als der Nagelkünstler bekannt. Im Film wird recht gut gezeigt, wie souverän er mit dem Kunstmarkt und den neuen Richtungen umgeht. Seine Verbindung zu Richter war eng, da er auch mit dem realistischen Sozialismus der DDR aufgewachsen ist.
Ueckers Hauptwerke, wie seine genagelten Reliefs, werden am Kunstmarkt auf eine halbe Million Euro oder mehr taxiert, so z. B. „Spirale I“, 1968, bei Sotheby’s (New York) $ 600.000,- bis $ 800.000,- oder „Feld/Field“, 2012–13, bei Dorotheum (Wien) auf € 400.000,- bis € 600.000,-. Anfang der 1970er Jahre wurden solche Bilder noch mit umgerechnet etwa € 10.000,- gehandelt. Die städtische Kunstsammlung Bonn konnte ein solches Nagelbild sogar noch zum Freundschaftspreis von DM 4.000,- erwerben.
Auch Polke stammt aus der DDR. Seine Malerei ist dem postmodernen Realismus zuzuordnen (Kapitalistischer Realismus) und zitiert Ausdrucksweisen der Pop Art, ohne dass er dieser Stilrichtung zuzurechnen ist. Seine Haltung zur Malerei enthält stark ironische Elemente.
Der Begriff Kapitalistischer Realismus wurde zwischen 1963 und 1966 von den Malern Gerhard Richter, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Manfred Kuttner eingeführt, um unter diesem Titel Selbsthilfeausstellungen und Performances zu veranstalten.
Der erfolgreichste von ihnen und der mit hoher Anerkennung schließlich ist Gerhard Richter. Ich beschäftigte mich mit ihm erst 2015 näher als im Neuen Museum Nürnberg eine Sonderausstellung gezeigt wurde.
Im Film wird gut gezeigt der Übergang von seinen Experimenten in Düsseldorf, die ihn nicht befriedigen konnten, zu seiner Passion des Verfremdens von realistischen Motiven. Er legte Fotos unter ein Episkop und projizierte die nun stark vergrößerten Bilder auf eine leere Leinwand. Auf ihr zog er mit Kohle nach und pinselte Menschen wie Räume mit schwarzer, grauer und weißer Farbe aus. Die noch nassen Farben übermalte er mit einem breiten Pinsel, zog die Konturen ineinander, egalisierte die Kontrastunterschiede.“
In der Ausstellung wurden Bilder aus verschiedenen Epochen gezeigt. Auch der Übergang zur farbigen Gestaltung mit neueren Werken. Bei manchen Bildern, die bestimmt ihren Preis hatten, kam mir aber der Gedanke, dass es sich um verunglückte Werke also Ausschuss handeln könnte. Wenn man mal einen Namen hat, kann man ja alles verkaufen. Mir hatten damals besonders gefallen:
Sehenswert ist eine Dokumentation über ihn (auf DVD erhältlich) in der seine Arbeitsweise in den letzten Jahren gezeigt wird: Mit riesigem Atelier, Assistenten, Planung von Ausstellungen und seiner aktuelleren Maltechnik.
Die Geschichte des Films "Werk ohne Autor" hat durchaus realistischen Hintergrund: Der Vater von seiner ersten Ehefrau Ema war Heinrich Eufinger, der im Zweiten Weltkrieg als SS-Obersturmbandführer die Dresdner Frauenklinik leitete und dort Zwangssterilisationen vornahm. Eufinger wurde nach Ende des Krieges in einem sowjetischen Lager interniert, und rettete dort der Frau des sowjetischen Lagerkommandanten das Leben. So arbeitete er später in der DDR wieder als Chefarzt in gynäkologischen Abteilungen, ehe er in den Westen umsiedelte.
In der Öffentlichkeit erfuhr der Name Eufinger erst durch die Werke des Malers Gerhard Richter postume Bekanntheit. Da Gerhard Richter in den Jahren 1957 bis 1982 mit Eufingers Tochter Ema verheiratet war, hat er auch seinen Schwiegervater Eufinger in den fünfziger und sechziger Jahren mehrfach porträtiert. 2004 wurde durch einen Zeitungsartikel im Tagesspiegel ein tragischer Aspekt in Gerhard Richters Familie bekannt. Seine Tante Marianne Schönfelder war im Februar 1945 in der zweiten Phase des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms, der Aktion Brandt, nach ihrer Zwangssterilisierung durch systematische Unterernährung ermordet worden. Sein späterer Schwiegervater Heinrich Eufinger gehörte als SS-Obersturmbannführer und Verantwortlicher für die Zwangssterilisierungen in Dresden zu den Tätern. Gerhard Richter wusste bei seiner Heirat mit Ema Eufinger von diesen Zusammenhängen nichts. Er hat aber im Jahr 1965 mit dem Gemälde Herr Heyde, das die Verhaftung des hauptverantwortlichen SS-Arztes für die Massenmorde an körperlich und geistig behinderten Menschen zum Thema hat, die Euthanasie als einer der ersten bildenden Künstler in der Nachkriegszeit behandelt, und mit dem Gemälde Tante Marianne den Opfern der Euthanasie ein Gesicht gegeben.